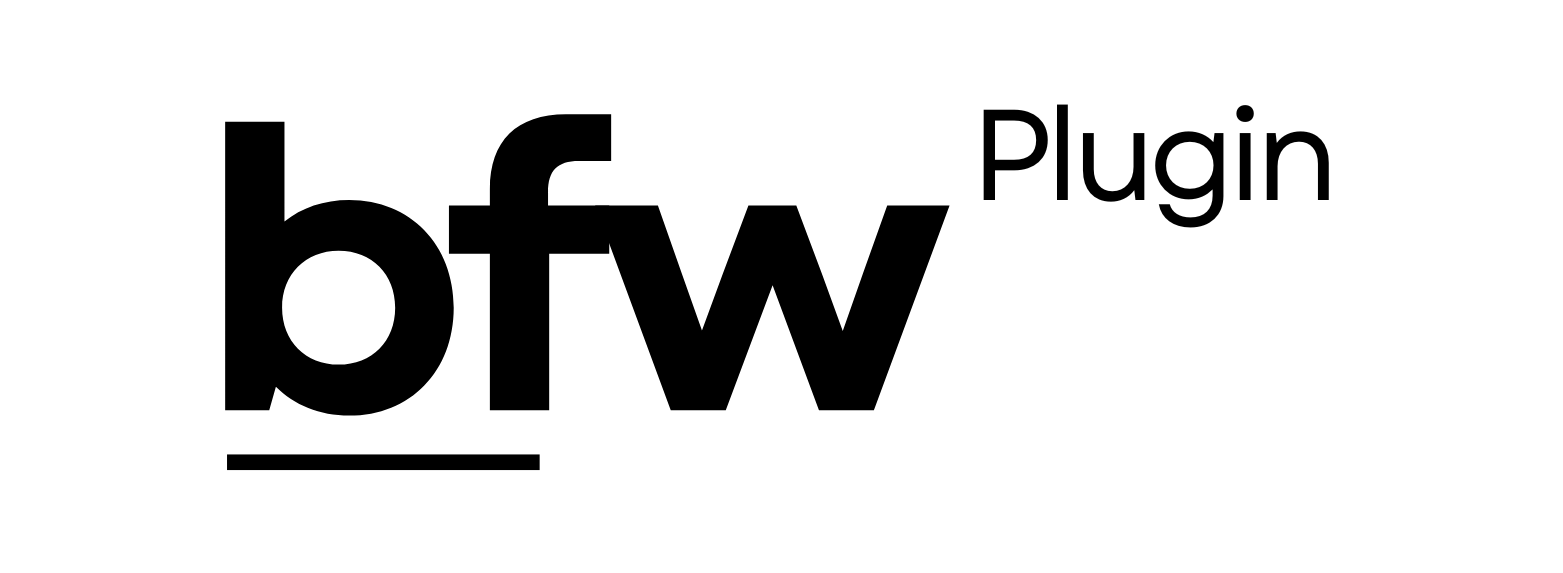Fehler bei der Barrierefreiheit: Die häufigsten Probleme auf Websites – und wie sie sich vermeiden lassen
Trotz klarer rechtlicher Vorgaben und zunehmender Sensibilisierung gehören Fehler bei der Barrierefreiheit weiterhin zu den häufigsten Problemen im Web. Dabei betreffen sie über eine Milliarde Menschen weltweit: Etwa 15% der Weltbevölkerung leben mit einer Form von
Behinderung – ob körperlich, sensorisch, kognitiv oder neurologisch. Eine barrierefreie Website ist heute nicht nur eine soziale Verantwortung, sondern zunehmend auch eine gesetzliche Verpflichtung. Dennoch schleichen sich in vielen digitalen Angeboten immer wieder Barrierefreiheitsfehler ein, die Nutzer*innen mit Einschränkungen ausschließen. In diesem Beitrag erfahren Sie, welche Fehler bei der Barrierefreiheit am häufigsten auftreten – und wie diese professionell behoben werden können.
Was sind Fehler bei der Barrierefreiheit im Web?
Fehler bei der Barrierefreiheit sind technische oder gestalterische Hindernisse, die Menschen mit Behinderung daran hindern, Websites gleichberechtigt zu nutzen. Diese Barrieren betreffen weit mehr als nur Menschen mit Seh- oder Hörbeeinträchtigungen.
Betroffene Nutzergruppen:
• Menschen mit Sehbehinderung oder Blindheit (z.B. abhängig von Screenreadern)
• Hörgeschädigte oder gehörlose Menschen (z.B. benötigen Untertitel)
• Personen mit motorischen Einschränkungen (z.B. auf Tastaturnavigation angewiesen)
• Menschen mit kognitiven oder Lernschwierigkeiten (z.B. benötigen klare, einfache Sprache)
• Nutzer*innen mit neurologischen Erkrankungen (z.B. Epilepsie – sensibel gegenüber Animationen)
• Personen mit Sprach- oder Leseschwierigkeiten (z.B. durch Legasthenie, Aphasie)
Barrieren entstehen häufig, wenn:
• Websites nicht semantisch korrekt aufgebaut sind (z.B. falsche Überschriftenstruktur)
• Designentscheidungen, die Lesbarkeit erschweren (z.B. zu geringe Kontraste)
• Interaktive Elemente nicht per Tastatur bedienbar sind Inhalte für Assistenztechnologien nicht zugänglich gemacht wurden
Häufige Fehler bei der Barrierefreiheit im Web – und wie Sie sie vermeiden
Digitale Barrierefreiheit bedeutet, dass alle Menschen – unabhängig von körperlichen, sensorischen oder kognitiven Einschränkungen – Webseiten und digitale Inhalte gleichberechtigt nutzen können. In der Praxis zeigen sich jedoch immer wieder typische
Fehler, die den Zugang erschweren oder verhindern. Im Folgenden finden Sie die häufigsten Barrierefreiheitsfehler im Web – inklusive konkreter Lösungen.
1. Fehlende oder unzureichende Alternativtexte für Bilder
Problem:
Bilder ohne präzise Alternativtexte (alt-Attribute) sind für Nutzer*innen, die auf Screenreader angewiesen sind, nicht zugänglich. Wenn der Alt-Text fehlt oder ungenau ist, können wichtige Informationen nicht korrekt vermittelt werden, was insbesondere für blinde oder stark sehbehinderte Personen ein erhebliches Hindernis darstellt.
Lösung:
• Verwenden Sie für jedes sinntragende Bild einen präzisen, beschreibenden Alt-Text.
• Für dekorative Bilder genügt alt=““ – sie sollen von Screenreadern ignoriert werden.
• Bei verlinkten Bildern muss auch der Alternativtext den Zweck des Links vermitteln.
2. Unzureichender Farbkontrast
Problem:
Wenn der Farbkontrast zwischen Text und Hintergrund zu gering ist, können viele Nutzer*innen – besonders Menschen mit Sehbehinderungen oder Farbblindheit – den Text schwer lesen. Ein schlechter Kontrast kann zu einer schlechten Nutzererfahrung führen und den Zugang zu wichtigen Informationen verhindern.
Lösung:
• Achten Sie auf ein Mindestkontrastverhältnis von 4,5:1 bei normalem Text.
• Für große oder fett gesetzte Schrift ist ein Verhältnis von 3:1 ausreichend.
• Nutzen Sie Farbkontrast-Tools, um die Lesbarkeit frühzeitig im Designprozess zu prüfen.
3. Fehlerhafte Überschriftstruktur
Problem:
Eine inkonsistente oder willkürliche Gliederung von Überschriften (z.B. das Springen von einer H2-Überschrift zu einer H4-Überschrift ohne eine H3 dazwischen) erschwert es Nutzern, die auf Assistenztechnologien angewiesen sind, die Struktur und den Inhalt einer Seite zu erfassen. Eine logische und konsistente Struktur ist besonders wichtig für Screenreader-Nutzer*innen, um sich effizient durch den Inhalt zu navigieren.
Lösung:
• Verwenden Sie auf jeder Seite eine einzige für den Haupttitel.
• Bauen Sie die Überschrifthierarchie logisch auf (<h2>,<h3>, usw.) – ohne Sprünge.
• Trennen Sie die visuelle Gestaltung (z.B. Schriftgröße) von der semantischen Struktur (HTML-Tags).
4. Nicht klar strukturierte oder überladene Navigation
Problem:
Eine unübersichtliche oder zu komplexe Navigation kann für Nutzer*innen, die auf Screenreader angewiesen sind, verwirrend sein. Fehlt eine klare Struktur oder semantische Kennzeichnung, wird die Navigation schwierig und zeitraubend.
Lösung:
• Nutzen Sie das <nav>-Element zur semantischen Kennzeichnung von Navigationsbereichen.
• Bieten Sie einen „Zum Hauptinhalt springen“-Link an, um die Navigation überspringen zu können.
5. Formularfelder ohne erkennbare Labels
Problem:
Wenn Formularfelder keine klaren Labels haben, können Nutzer*innen mit Screenreadern nicht erkennen, welche Informationen sie eingeben sollen. Das Fehlen von Labels oder die Verwendung von Platzhaltertext als Ersatz erschwert die Benutzerfreundlichkeit und führt zu Verwirrung.
Lösung:
• Verknüpfen Sie jedes Eingabefeld mit einem <label>
• Stellen Sie sicher, dass die Beschriftungen eindeutig, kontextbezogen und gut sichtbar sind.
• Verwenden Sie gegebenenfalls ergänzende ARIA-Attribute wie aria-describedby für zusätzliche Hinweise.
6. Allgemeine oder nichtssagende Linktexte
Links mit vagen Bezeichnungen wie „Hier klicken“ oder „Mehr erfahren“ bieten keine klare Information darüber, wohin der Link führt. Nutzer*innen, die Screenreader verwenden, können nicht nachvollziehen, was sie erwartet, wenn sie den Link aktivieren.
Lösung:
7. Keine Tastaturnavigation möglich
Problem:
Lösung:
8. Videos ohne Untertitel oder Transkripte
Problem:
Videos ohne Untertitel oder Transkripte schließen gehörlose oder schwerhörige Nutzer*innen aus und erschweren es allen, die Inhalte in lauten Umgebungen oder ohne Ton zu verstehen.
Lösung:
• Bieten Sie geschlossene Untertitel (Closed Captions) für alle gesprochenen Inhalte an.
• Ergänzen Sie längere Videos um ein vollständiges Transkript.
• Achten Sie bei eingebetteten Playern darauf, dass diese selbst barrierefrei bedienbar sind.